In nichtöffentlicher Sitzung
- Beratende Kommissionen: Ersetzung von Mitgliedern
- Commission des subsides scolaires (Schulzuschusskommission): Ersetzung von Mitgliedern
- Sozialamt: Personalangelegenheiten – Stellungnahme
- Fondation J.-P. Pescatore: Personalangelegenheiten – Stellungnahme
- Personalangelegenheiten – Beschlussfassung
- Personalangelegenheiten: Klagebefugnisse – Beschlussfassung
In öffentlicher Sitzung
7. Fragen der Mitglieder des Gemeinderats
8. Verkehr: endgültige Änderungen des Verkehrsreglements – zeitlich befristete Reglemente – Bestätigung zeitlich befristeter Reglemente – Beschlussfassung
9. Verträge – Billigung
10. Kostenvoranschläge – Billigung:
- Detailliertes endgültiges Projekt für die Planung und den Bau einer Wohnanlage mit 21 Wohneinheiten und 1 Geschäft in 46, boulevard Konrad Adenauer in Luxemburg-Kirchberg (Projekt PAP KI-14A_Lot 3)
- Detailliertes endgültiges Projekt für die Planung und den Bau einer Wohnanlage mit 15 Wohneinheiten in 242, Val des Bons-Malades in Luxemburg-Kirchberg (Projekt PAP KI-14B_Los 2)
11. Städtebau:
- Punktuelle Änderung des PAG – Sportanlage Hamm – Am Laangfeld – Befassung
- Parzellierung von Grundstücken gemäß Art. 29 des Kommunalplanungsgesetzes (loi aménagement communal) – Beschlussfassung
12. Umweltbericht 2023 und Umweltaktionspläne 2021/2022 – Vorstellung
13. Aktionspläne für die Lärmbekämpfung – Stellungnahme
- Entwurf eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Straßenverkehrslärm
- Entwurf eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Lärm durch den Schienenverkehr
- Entwurf eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Fluglärm
- Entwurf eines Aktionsplans zur Lärmbekämpfung im Großraum Luxemburg
14. Antrag der Partei déi Lénk auf eine strikte Begrenzung der Nachtflüge am Flughafen Luxemburg – Abstimmung
15. Forstwirtschaftspläne der Stadt für das Haushaltsjahr 2026 – Billigung
16. Gewährung von Zuschüssen – Beschlussfassung
17. Congrégation des Sœurs Hospitalières de Ste Elisabeth: Einräumung von Erbpachtrechten – Stellungnahme
18. Sozialamt: Verkauf einer Parzelle – Stellungnahme
19. Rechtsangelegenheiten: Klagebefugnisse – Beschlussfassung
20. Allgemeine Verlängerung der Öffnungszeiten von Gaststätten, die alkoholische bzw. alkoholfreie Getränke ausschenken, bis 3:00 Uhr morgens am 3. und 4. Oktober 2025 anlässlich der Feierlichkeiten zur Thronbesteigung Seiner Königlichen Hoheit Großherzog Guillaume – Beschlussfassung
21. Schaffung/Streichung von Stellen – Beschlussfassung
Live-Übertragung der Sitzungen
Schauen Sie das Video dieser Sitzung an.
Analytischer Bericht
Der analytische Bericht enthält die vom Gemeinderat abgehaltenen Diskussionen und getroffenen Entscheidungen. Er dient den Bürgerinnen und Bürgern der Hauptstadt als wichtiges Informationsmittel, das es ihnen ermöglicht, sich über diejenigen Projekte und Maßnahmen zu informieren, die Auswirkungen auf ihr Alltagsleben haben.
Der analytische Bericht dieser Sitzung wird zeitnah bereitgestellt.
Weiterlesen
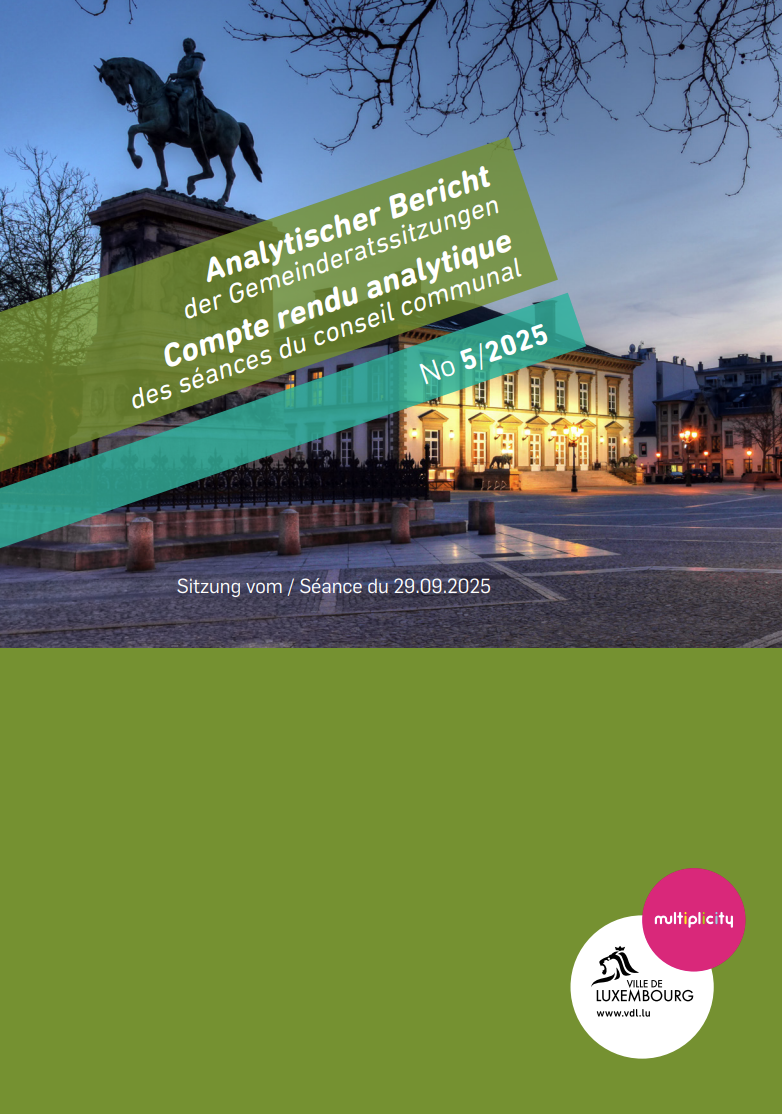
Weiterlesen
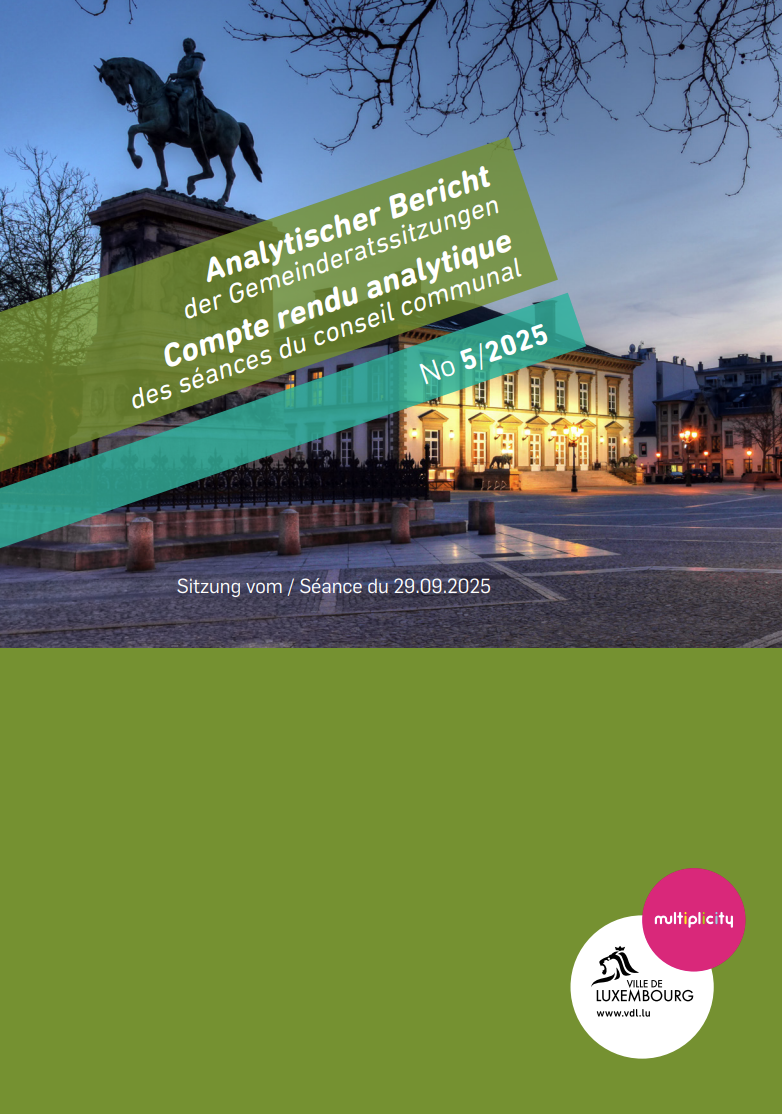
Von den Gemeinderatsmitgliedern gestellte Fragen
Schaffung eines nationalen Registers für bezahlbaren Wohnraum (RENLA) sowie eines nationalen Gebäude- und Wohnungsregisters (RNBL)
Frage von Rat David Wagner
In der Ausgabe vom 11. August 2025 der Wochenzeitung Lëtzebuerger Land hat sich Frau Bürgermeisterin gegen die Schaffung eines nationalen Registers für bezahlbaren Wohnraum (Registre national des logements abordables, RENLA) sowie des von der Regierung geplanten nationalen Gebäude- und Wohnungsregisters (Registre national des bâtiments et des logements, RNBL) ausgesprochen. Selbstverständlich ist es das gute Recht der Bürgermeisterin, eine Meinung über die erwähnten Verzeichnisse zu haben – auch wenn es erstaunlich ist, dass sie sich gegen Projekte ausspricht, die von ihrer eigenen Mehrheit in der „Chamber“ getragen werden. Als „déi Lénk“ sind wir aber der Meinung, dass diese Position nicht in die richtige Richtung geht.
Während wir mit einer schweren Wohnungskrise konfrontiert sind, stehen in der Hauptstadt Wohnungen seit Jahren oder Jahrzehnten leer. Wir haben deshalb stets gefordert, eine Abgabe auf Wohnungen einzuführen, die aus unerklärlichen Gründen leer stehen gelassen werden. Die Versuche, in der Hauptstadt ein Register einzuführen, sind leider gescheitert. Aus einer ganzen Reihe von Gründen ist es schwierig herauszufinden, wie die einzelnen Wohnungen genutzt werden. Das beginnt mit dem Problem, dass für Wohnungen, die vor dem Jahr 1988 gebaut wurden, kein vertikales Kataster besteht. Zudem musste man bis zum Jahr 2022 keinen Beweis liefern, dass man tatsächlich an der angegebenen Adresse wohnt, um sich in der Stadt Luxemburg anzumelden.
Deshalb ist es begrüßenswert, dass die vorige Regierung die Initiative ergriffen hatte, ein Register zu erstellen.
Ich habe diesbezüglich folgende Fragen:
- Kann Frau Bürgermeisterin dem Gemeinderat ihre Stellungnahme gegenüber dem Lëtzebuerger Land bestätigen?
- Falls Frau Bürgermeisterin ihre Haltung bestätigt, kann sie dann auch bestätigen, dass diese die Haltung des gesamten Schöffenrats widerspiegelt?
- Wurde diese Haltung bereits innerhalb des Syvicol vertreten?
- Welche Lösungen schlägt Frau Bürgermeisterin vor, um festzustellen, welche Wohnungen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg derzeit leer stehen und für Wohnzwecke genutzt werden können?
- Welche Gründe würden die Schaffung eines nationalen Registers für bezahlbaren Wohnraum verhindern?
Antwort von Bürgermeisterin Lydie Polfer
Ich freue mich über diese Frage, da sie mir die Gelegenheit gibt, auf Sachverhalte zurückzukommen, die bestimmt nach bestem Wissen und Gewissen von einem Journalisten geschrieben wurden, nachdem er Mitte August über Telefon mit mir gesprochen hatte. Dabei wurden einige Dinge nicht so verstanden, wie sie gesagt wurden und gemeint waren.
Beginnen wir mit dem Einfachsten: Das RENLA existiert bereits und wir arbeiten damit! Alle unsere „logements abordables“ – die früher als „logements sociaux“ (Sozialwohnungen) bezeichnet wurden – laufen über den RENLA, wenn sie frei werden.
Was das „Registre national des bâtiments et des logements“ (RNBL) betrifft, setzt die Erstellung eines solchen nationalen Verzeichnisses voraus, dass es kommunale Verzeichnisse gibt, auf die es aufbauen kann. Im erwähnten Presseartikel habe ich darauf hingewiesen, dass es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gibt, in den Gemeinden ein „Registre communal des bâtiments et des logements“ zu erstellen. Sowohl die aktuelle Regierung als auch die vorherige wissen, dass das vorliegende Gesetzesprojekt in der aktuellen Form nicht umgesetzt werden kann. Das Gutachten des Staatsrats enthält drei „oppositions formelles“. Das Syvicol meint in seinem Gutachten, das vorliegende Gesetzesprojet weise ein starkes Ungleichgewicht auf („est très déséquilibré“). Während die ganze Verantwortung für die Erstellung eines kommunalen Verzeichnisses beim Bürgermeister liegen würde, würden die Strafzahlungen vom Staat eingenommen werden. Das Syvicol sieht noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, die in der vorliegenden Form nicht zurückbehalten werden können.
Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht weiter an der Umsetzung dieser Idee gearbeitet werden muss. Die bestehenden Unklarheiten müssen beseitigt werden. Dazu gehört insbesondere die Frage, wie eine leerstehende Wohnung definiert wird. Könnte man auf Strom- oder Wasserrechnungen zurückgreifen? Würde das nicht zu weiteren „oppositions formelles“ führen? Klar ist, dass die Definition auf nationaler Ebene einheitlich sein muss. Am 7. Oktober 2022 hatten wir in der „Chamber“ eine sehr interessante Diskussion über die auf dem Tisch liegenden Vorschläge. Dabei wurden alle diese Fragen aufgeworfen: Wann gilt eine Wohnung als unbewohnt? Und was kann man als Wohnung bezeichnen? Ist z. B. in einer „Co-Living“-Struktur jedes Zimmer eine Wohnung? Dieses Beispiel zeigt, wie schwer eine Definition ist.
Was die Stadt Luxemburg betrifft: Seit 2014 werden alle Baugenehmigungen digital gespeichert. Seit dem Frühjahr 2025 verfügen wir über ein neues Instrument, um auch die vor dem Jahr 2014 erteilten Baugenehmigungen aufzunehmen. Das ist eine Herkulesarbeit, die irgendwann gemacht werden muss. Will man über ein vollständiges kommunales Verzeichnis aller Bauten verfügen, muss man auch die Gebäude, die auf das Mittelalter zurückgehen und für die es keine Pläne gibt, darin aufnehmen. Ich stelle das nicht in Frage, doch es stellt eine enorme Arbeit dar. Und diese Arbeit wird gemacht werden. Wir sind darauf vorbereitet.
Dann zur wichtigen Frage, wo sich leerstehende Wohnungen befinden: 2022 wurde diese Frage von einem Minister der vorigen Regierung angesprochen. Er hat vorgeschlagen, die Beweislast umzukehren, d. h., dass nicht die Gemeinden beweisen müssen, dass eine Wohnung unbewohnt ist, sondern, dass die Eigentümer/innen beweisen müssen, dass eine Wohnung bewohnt ist. In einer Sitzung im Beisein von Vertretenden des „Observatoire de l’habitat“ habe ich vor ein paar Tagen darauf hingewiesen, dass der Staat über alle erforderlichen Informationen verfügt. Die Einregistrierungs-, Domänen- und Mehrwertsteuerverwaltung weiß, wer welche Wohnung besitzt. Das Finanzamt weiß, wie viel jeder Eigentümer für seine Wohnungen einnimmt. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wer zu welchen Informationen Zugang haben darf. Ein ehemaliger Minister hat diesbezüglich einen konkreten Vorschlag gemacht. Es wäre die Mühe wert, dies zu analysieren. Man würde dadurch schneller vorankommen. Denn die Erstellung des kommunalen Verzeichnisses wird noch einige Zeit dauern.
Wenn es eine Gemeinde gibt, die ein solches Register erstellen will, ist es die Stadt Luxemburg. Denn im Jahr 2008, als die Gemeinden durch den ersten „Pacte logement“ die Möglichkeit erhielten, ein solches Register auszuarbeiten, war die Stadt Luxemburg die erste Gemeinde, die das in die Wege geleitet hat: Der Gemeinderat erteilte dem Schöffenrat den Auftrag, alle Eigentümer/innen schriftlich zu kontaktieren, um Angaben über die in ihrem Besitz befindlichen Wohnungen zu erhalten. Es wurden jedoch juristische Schritte dagegen eingeleitet, und im Jahr 2011 hat der Verwaltungsgerichtshof alles annulliert. Der Gerichtshof vertrat die Ansicht, der Gemeinderat habe nicht die Befugnis gehabt, für den Fall der Nichtbeantwortung solcher Fragen strafrechtliche Sanktionen vorzusehen, ohne gegen den Grundsatz zu verstoßen, dass niemand gezwungen werden darf, sich selbst zu belasten („n’aurait d’ailleurs pas eu le pouvoir, en tout cas en sanctionnant la non-réponse à de telles questions de sanctions pénales, sous peine de violer le principe de l’interdiction d’obliger une personne de s’auto-incriminer“). Die von der Stadt Luxemburg in den Jahren 2008 bis 2011 unternommenen Anstrengungen wurden somit zunichte gemacht. Nichtsdestotrotz sind wir alle der Meinung, dass leerstehende Wohnungen mobilisiert werden müssen.
In einem Zeitungsartikel hat jemand darauf hingewiesen, dass zwischen 8 und 10 Prozent der Wohnungen, die der Stadt Luxemburg gehören, leer stehen. Das ist richtig. Diese Wohnungen stehen jedoch nicht leer, sondern werden renoviert. Bei über 800 Wohnungen ist es normal, dass jedes Jahr zwischen 8 und 10 Prozent davon renoviert werden.
Der Schöffenrat ist mit niemandem auf Konfrontationskurs – im Gegenteil: Wir setzen auf Zusammenarbeit und Beratung, um Gesetzestexte zu ermöglichen, die standfest sind und dem Arbeitspensum, das anfällt, um die gewünschten Verzeichnisse zu erstellen, Rechnung tragen. Wir haben schon entsprechende Unterredungen geplant. Die Einwohner/innen werden derzeit an einer Adresse angemeldet, doch wir wissen nicht, auf welcher Etage sie wohnen. Würde man über diese Information verfügen, könnten z. B. verschiedene Hilfsangebote leichter organisiert werden.
Wir müssen nach Lösungen suchen, um möglichst schnell festzustellen, wo Wohnungen ohne Ursache – oder aus den falschen Ursachen – leer stehen. Dieses Thema wird uns noch oft und lange beschäftigen, und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, gute und nachhaltige Lösungen zu finden.
Ewigkeitschemikalien (PFAS und TFA)
Frage von Rätin Linda Gaasch
PFAS-Schadstoffe (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen), darunter auch TFA (Trifluoracetat), sind sogenannte Ewigkeitschemikalien. Sie kommen insbesondere im Trinkwasser vor. Ihre Auswirkungen, insbesondere die Anreicherung in der Umwelt und im menschlichen Körper, geben Anlass zur Sorge.
- Wie hoch ist die Konzentration von PFAS und TFA im Quellwasser der Stadt Luxemburg? Wie hoch ist die Konzentration im Trinkwasser, das die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern liefert?
- Inwieweit können PFAS und TFA durch die Aufbereitung des Wassers aus den verschiedenen Quellen entfernt werden? Werden im Bereich der Wasseraufbereitung zusätzliche Maßnahmen ergriffen?
- Inwieweit fördert die Stadt die Reduzierung von PFAS, um eine Freisetzung in die Umwelt zu vermeiden, beispielsweise durch Alternativen zum Einsatz von Pestiziden in der Nähe von Quellen, durch Alternativen zu Einwegprodukten im Rahmen von Veranstaltungen oder indem darauf geachtet wird, aus welchen Materialien die Arbeitskleidung des Personals der Stadt Luxemburg besteht?
- Welche Bedingungen stellt die Stadt Luxemburg an Pächter/innen, wenn sie landwirtschaftliche Flächen verpachtet? Wie und wie oft wird die Einhaltung dieser Bedingungen kontrolliert? Wurden in den letzten Jahren Unregelmäßigkeiten festgestellt, und welche Konsequenzen hatten diese? Wie viele solcher Pachtverträge bestehen derzeit?
Antwort von Schöffin Simone Beissel
Die PFAS sind in sehr vielen Produkten, die wir im Alltag nutzen, zu finden, von den Kleidern über Anti-Haft-Beschichtungen bis hin zum Trinkwasser und zum Lösch-Schaum der Feuerwehr. Es besteht diesbezüglich eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2020 und ein nationales Gesetz von 2022. Die EU-Richtlinie betrifft 20 der insgesamt rund 10.000 PFAS. Während die Richtlinie sich nicht mit Trifluoracetat (TFA) befasst, hat die Luxemburger Gesetzgebung diesbezüglich Grenzwerte von 500 bis 1500 Nanogramm pro Liter festgelegt – ein sehr geringer Wert also, doch die PFAS sind überall.
Im Quellwasser sind zwischen 0 und 350 Nanogramm PFAS pro Liter enthalten. Im Wasser, das an die Haushalte verteilt wird (und dem auch SEBES-Wasser beigemischt wird), sind es zwischen 0 und 10 Nanogramm pro Liter – also ein extrem niedriger Wert. TFA wird dabei nicht erfasst. Wir sind dabei, nach Lösungen zu suchen, denn dabei können nicht die gleichen Methoden angewendet werden.
Bekanntlich gibt es drei Methoden zur Reinigung des Wassers: Aktivkohlefilter, ultraviolette Strahlen und Ozonbehandlung. Durch Aktivkohle können die PFAS aus allen unseren Quellen fast vollständig entfernt werden. Wir liegen weit unterhalb der Grenzwerte.
Am Standort „Tubishaff“ wurden tiefe Bohrungen durchgeführt. Im Wasser, das dadurch in großer Tiefe erschlossen wird, befinden sich glücklicherweise keine PFAS, so dass sich eine entsprechende Behandlung des Wassers erübrigt.
Beim Kauf von Arbeitskleidung für die Mitarbeitenden der Stadt Luxemburg achten wir darauf, dass die Kleidung aus biologischer Baumwolle ohne PFAS besteht.
Seit 2011 bestehen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass bei Veranstaltungen PFAS vermieden werden, so z. B. durch wiederverwertbare Becher aus Hartplastik. Die Stadt Luxemburg selbst benutzt nur Porzellan und Glas.
Wir haben derzeit 138 Pachtverträge abgeschlossen, davon 14 durch öffentliche Ausschreibung und die restlichen „de gré à gré“. Wir sind dabei sehr streng: Die Pächter/innen müssen sich zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung verpflichten, was bedeutet, dass sie keinen chemischen Dünger und keine Pestizide einsetzen dürfen. Das wird auch von fast allen Pächtern eingehalten – mit einer Ausnahme. Bei Verstößen gegen die Abmachungen wird zuerst mit den betroffenen Personen gesprochen, um sie auf ihre eingegangenen Verpflichtungen hinzuweisen. Im Wiederholungsfall werden alle Verträge aufgekündigt. Das haben wir im besagten Fall getan, mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten, die am 1. November abläuft. Die Stadt Luxemburg muss mit gutem Beispiel vorangehen.
Wir tun also ein Maximum, um die PFAS zu reduzieren und sicherzustellen, dass keine Gefahr für die Gesundheit oder für die Umwelt besteht. Wir liegen deutlich unter den in Luxemburg und in Europa erlaubten Grenzwerten, dies insbesondere durch die Behandlung des Wassers mit Aktivkohle. Wir sind streng mit den Pächtern und beim Einkauf von Kleidung.
Eröffnung der neuen Grundschule in Kirchberg
Frage von Rat Gabriel Boisanté
Am 15. September 2025 wurde die neue Grundschule in Kirchberg eröffnet. Zum Zeitpunkt meiner Anfrage bestanden noch Unsicherheiten hinsichtlich der vollständigen Verfügbarkeit der Infrastruktur, des Mobiliars und der Materialien, die für einen normalen Schulbetrieb ab Beginn des neuen Schuljahres erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund hatte ich folgende Fragen gestellt:
- Wird die Schule am 15. September 2025 bereit sein, Schüler/innen und Lehrkräfte unter normalen Bedingungen und ohne Störungen des Unterrichtsbetriebs aufzunehmen?
- Werden die erforderlichen Schulmaterialien und Möbel zum ersten Schultag vollständig verfügbar und installiert sein?
- Falls nicht, warum wurden die Arbeiten, der Umzug und die Organisation nicht so geplant, dass diese Situation vermieden werden konnte?
Ich möchte noch eine Frage zu den Wartelisten, insbesondere für die Schulfoyers, hinzufügen. Die Stadt Luxemburg muss für eine optimale Kommunikation mit den Eltern sorgen. Die rechtzeitige Information der Eltern muss auf politischer Ebene Priorität haben.
Antwort von Schöffe Paul Galles
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass der Schulbeginn sehr gut verlaufen ist. Bürgermeisterin Lydie Polfer und ich waren zu diesem Anlass in der Schule im Bahnhofsviertel, um ein Zeichen zu setzen, nachdem der Gemeinderat im vergangenen Jahr die Zusammenlegung der beiden Schulen in diesem Viertel beschlossen hatte.
In der darauffolgenden Woche habe ich der Schule in Kirchberg einen informellen Besuch abgestattet. Die Erweiterung dieser Schule konnte rechtzeitig zum Schulbeginn eröffnet werden. Die beauftragten Firmen haben kurz vor der Eröffnung noch viel gearbeitet, um diese Notwendigkeit zu erfüllen. Für den Schöffenrat war es ganz klar, dass die Eröffnung an dem Tag stattfinden musste. Es gab keinen Plan B.
Einige Kleinigkeiten bleiben noch zu erledigen. Dazu zählen z. B. runde Fenster zwischen dem Speisesaal und einem Gang im Inneren des Gebäudes. Es handelt sich also nicht um Fenster nach außen. Mit den Firmen wurde festgehalten, dass diese Arbeiten schnellstmöglich durchgeführt werden, und dies zu einem Zeitpunkt, wenn die Kinder nicht im Gebäude sind. Es hat also alles gut geklappt und ich habe den Eindruck, dass jeder mit dem neuen Gebäude zufrieden ist.
Schutzmaßnahmen für Obdachlose bei Extremwetterereignissen
Frage von Rätin Marie-Marthe Muller
Der Abend und die Nacht vom 8. auf den 9. September waren von heftigen Unwettern geprägt, die innerhalb kürzester Zeit zu einem Hochwasser der Alzette im Val de Hamm (Pulvermühle) und im Pfaffenthal führten. Auch in anderen Stadtteilen gab es Überschwemmungen. Laut Experten erreichte die Niederschlagsmenge mancherorts bis zu 149 Liter pro Quadratmeter. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch die Sachschäden sind hoch.
Der Krisenstab hat gut funktioniert und die zuständigen Dienststellen haben gute Arbeit geleistet. Ich danke allen Beteiligten und gratuliere ihnen zu ihrer professionellen Arbeit, insbesondere angesichts des raschen Anstiegs der Wassermassen.
Ich möchte die Aufmerksamkeit des Schöffenrats auf die besorgniserregende Lage der Obdachlosen lenken, von denen die meisten die Nacht im Freien verbringen mussten und den Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Eine Person, die derzeit im Pfaffenthal campiert, fand keine Unterkunftsmöglichkeit und musste diese schwierigen Wetterbedingungen direkt erdulden. Da andere Obdachlose sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation befanden, möchte ich folgende Fragen stellen:
- Könnten die Akteure vor Ort, die die Obdachlosen kennen, Teil des Krisenstabs sein, um die Hilfsmaßnahmen zur Rettung dieser Menschen zu leiten?
- Notunterkunft für Obdachlose einzurichten? (z. B. eine Sporthalle)
- Werden die verschiedenen sozialen Partnerorganisationen der Stadt Luxemburg, die im Bereich Obdachlosigkeit tätig sind, von der Stadt direkt über Wetterbedingungen wie die in der Nacht vom 8. auf den 9. September 2025 informiert?
- Aufgrund des Klimawandels werden extreme Wetterereignisse immer häufiger auftreten. Sind Obdachlose in den Plänen zum Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Luxemburg vor solchen Ereignissen berücksichtigt?
Antwort von Schöffin Corinne Cahen
Ich bedanke mich im Namen der zuständigen Dienststellen für das von Rätin Muller ausgesprochene Lob. Es funktioniert in der Tat sehr gut hier in der Stadt Luxemburg. Die Dienststellen sind gut untereinander vernetzt. Selbst, wenn einmal eine Dienststelle nicht in der „Cellule de crise“ vertreten sein sollte, weiß diese genau, wie sie die zuständigen Dienststellen erreichen kann. Dazu zählen auch die Streetworker. Wir können darüber nachdenken, die „Direction Affaires sociales“ stärker in den Krisenstab einzubinden, doch ist bereits ein sehr guter Informationsfluss gewährleistet.
Was die obdachlose Person betrifft, die im Pfaffenthal campiert, möchte ich betonen, dass wir niemanden zwingen können, seinen Aufenthaltsort zu verlassen. Es wurde schon oft versucht, die betreffende Frau zu überzeugen, ihren Standort zu verlassen, doch es ist noch niemandem gelungen. Wir leben in einer freien Gesellschaft, und man kann Hilfe anbieten, doch diese Hilfe muss auch angenommen werden.
Die „Direction Affaires sociales“ und die „Cellule de crise“ stehen im Kontakt mit den Streetworkern. Den Obdachlosen eine Sporthalle zur Verfügung zu stellen, wäre nicht die einfachste Lösung, da die Obdachlosen sich über das ganze Stadtgebiet verstreut aufhalten. Es ist besser, mit Hilfe der Streetworker, die die betreffenden Personen kennen, für eine Unterbringung in bestehenden Strukturen zu sorgen – sofern die Obdachlosen damit einverstanden sind, denn zwingen können wir sie nicht.
Mit Beginn der „Wanteraktion“ wird die Unterbringung der Obdachlosen wieder leichter werden, weil dann mehr Betten zur Verfügung stehen. Die gesamte Bevölkerung des Großherzogtums wird durch Meteolux und „LU-Alert“ informiert, was gut funktioniert, so dass es wenig sinnvoll wäre, zusätzliche Wetterwarnungen nur für die Stadt Luxemburg einzuführen.
Die Notfallpläne berücksichtigen alle Personen, die sich auf dem Stadtgebiet aufhalten, also auch die Obdachlosen.
Rätin Muller hat zu Recht darauf hingewiesen, dass bei den Überschwemmungen niemand zu Schaden gekommen ist. Unsere Streetworker wissen, wo sich die Obdachlosen üblicherweise aufhalten. Wir werden weiterhin versuchen – auch mit Hilfe der in diesem Bereich tätigen Vereinigungen –, die Obdachlosen zu überzeugen, nicht draußen zu bleiben. Doch wenn das ihre Entscheidung ist, muss man diese respektieren. Es gibt aber durchaus Personen, die sich jahrelang gegen die angebotene Hilfe wehren und sich letztendlich doch bereiterklären, diese in Anspruch zu nehmen. Man soll also nicht aufgeben und den Obdachlosen – sofern sie Rechte in Luxemburg besitzen – immer wieder Hilfe anbieten, um eine nachhaltige Lösung zu finden und ein Lebensprojekt entwickeln zu können. Wenn sie keine Rechte in Luxemburg besitzen, sollte man versuchen, sie zu überzeugen, sich in das Land zu begeben, wo sie Rechte haben, um dort ein Lebensprojekt zu entwickeln – was besser ist als in Luxemburg auf der Straße zu leben.
Warteliste für die Schulfoyers
Frage von Rätin Christa Brömmel
Zu Beginn des Schuljahres 2025/26 scheinen 673 Anträge auf einen Platz in einem Schulfoyer der Stadt Luxemburg nicht positiv beantwortet worden zu sein, obwohl diese Anträge gemäß den von der Stadt festgelegten Kriterien berechtigt sind. Für 172 Kinder haben die Eltern keine andere Betreuungslösung als das Schulfoyer.
Die Situation ist nicht neu, was vermuten lässt, dass die Bemühungen der Stadt Luxemburg im Bereich der außerschulischen Betreuung unzureichend sind oder es an Ehrgeiz oder Ressourcen mangelt. Ich möchte daran erinnern, dass die ehemalige Rätin Ana Correia im Jahr 2022 eine diesbezügliche Frage gestellt hatte und ihr geantwortet wurde, dass etwa 750 Kinder auf der Warteliste standen, darunter 108, die keine Alternative zum Schulfoyer hatten.
- Kann der Schöffenrat die Zahl von 673 bzw. 172 offenen Anträgen zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen und deren Verteilung nach Schulen, Schulfoyers und Stadtteilen detailliert darlegen?
- Kann der Schöffenrat erläutern, welche konkreten Maßnahmen seit April/Mai 2025 (Zeitpunkt der Anmeldungen) ergriffen wurden, um die aktuelle Situation zu verhindern? Mit welchem Ergebnis?
Beim „City Breakfast“ vom 17. September hieß es, die Situation sei durch Personalmangel zu erklären.
- Wie hoch ist der Turn-Over des Personals in den Schulfoyers?
- Vor einigen Jahren wurde das Phänomen der Fehlzeiten beim Personal der Schulfoyers festgestellt. Wie hat sich die Fehlzeitenquote seit 2021 entwickelt? Im Jahr 2022 lag diese Quote bei etwas über 10 %. Wenn Fehlzeiten ein Problem darstellen, welche Maßnahmen wurden ergriffen, um sie zu senken? Mit welchem Ergebnis?
- Wie ist der Umstand zu erklären, dass die Stadt Luxemburg, die dem Betreuungspersonal sehr attraktive Verträge anbietet (mit einer Wochenarbeitszeit von 30 bis 40 Stunden statt 20 bis 25 Stunden oder weniger in anderen Gemeinden), nicht genügend Personal für die Schulfoyers rekrutieren kann?
- Wie lange dauert der Einstellungsprozess (von der Schaffung der Stelle bis zur Unterzeichnung des Vertrags)? Ist es möglich, diesen Prozess effizienter und kürzer zu gestalten?
- Gibt es in allen Stadtteilen genügend Räumlichkeiten? Ist die diesbezügliche Planung auf die Entwicklung in den kommenden Jahren ausgerichtet?
- Teilt der Schöffenrat meine Meinung, dass dringend ein Aktionsplan erforderlich ist, um eine Wiederholung der Situation in einem Jahr zu vermeiden? Wird der Schöffenrat diesen so schnell wie möglich ausarbeiten und umsetzen? Wird der Aktionsplan in der Schulkommission und in der Kinder- und Jugendkommission diskutiert werden?
Antwort von Schöffe Paul Galles
Derzeit sind 5746 Kinder in öffentlichen Grundschulen eingeschrieben, während die Gesamtzahl der auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg wohnenden Kinder im Grundschulalter bei rund 10 800 liegt. Für die Schulfoyers gab es 4461 Anfragen. Davon konnten wir 3800 sofort beantworten. Das erklärt die Zahl von 661 Anfragen, die in einem ersten Schritt nicht beantwortet werden konnten. Diese Zahl ändert sich ständig, insbesondere dank der Einstellung von zusätzlichem Personal.
Die Stadt Luxemburg hat sich Kriterien gegeben, um Prioritäten zu setzen, wenn dies erforderlich ist. Die erste Kategorie umfasst die Kinder, die unsere öffentliche Schule besuchen, die zweite Kategorie die Kinder, die eine Privatschule besuchen. Priorität haben jeweils diejenigen Kinder, die keine Betreuungsalternative haben und bereits in einem Schulfoyer eingeschrieben waren, dann diejenigen Kinder, die keine Betreuungsalternative haben und neu in einem Schulfoyer eingeschrieben werden sollen. Eine weitere Priorität gilt für diejenigen Kinder, die eigentlich eine Betreuungsalternative hätten, aber bei denen es eine soziale Begleitung gibt, z. B., wenn ein Elternteil zwar zuhause ist, sich aber wegen einer schweren Krankheit nicht um das Kind kümmern kann. Derzeit stehen 172 Kinder, die sich in einer dieser drei Situationen befinden, auf der Warteliste.
Besonders gezielt befassen wir uns mit den Kindern, für die keine Betreuungsalternative besteht. Es handelt sich dabei derzeit um 109 Kinder. Davon sind allerdings 30 Kinder, die die Früherziehung besuchen und demnach auch bei einer Kinderkrippe eingeschrieben werden könnten, so dass für diese Kinder zwar keine „alternative de garde“, aber eine „alternative de service“ besteht. Die anderen 79 Dossiers werden prioritär bearbeitet.
Um eine lange Auflistung von Zahlen zu vermeiden, schlage ich vor, dass ich Rätin Brömmel nachher das Zahlenmaterial, aufgeschlüsselt auf die einzelnen Stadtviertel, vorlege.
Wie gehen wir mit dieser Situation um? Ich möchte kurz auf die Frage von Rat Boisanté über die Kommunikation eingehen. Die Anfragen für die Schulfoyers gehen jeweils im April/Mai bei der Stadtverwaltung ein. Kurz vor den Sommerferien erfolgt der Abschluss, und es wird – auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Personalressourcen – festgestellt, wie viele Anfragen positiv beantwortet werden können. Daraufhin erhalten die Antragsteller eine Antwort. Dass darunter auch negative Antworten sind, erzeugt natürlich jeweils eine Reaktion. Die Situation hat sich gegenüber dem vergangenen Jahr nicht verschlechtert, sondern leicht verbessert. Jedes Jahr wird Anfang September im Rahmen einer „commission de validation“ analysiert, welche Posten noch verteilt werden können – weil zusätzliches Personal eingestellt werden konnte, oder weil sich gezeigt hat, dass das „Reserve“-Personal, das z. B. im Fall einer unerwarteten Zunahme der Zahl der Flüchtlingskinder zum Einsatz gekommen wäre, nun doch nicht in dem Rahmen benötigt wird. Dann erfolgt erneut eine Kommunikation an die Antragstellenden, ob es sich um eine Zusage oder um eine Absage handelt.
Wie gehen wir prinzipiell vor? Wir setzen auf zwei Punkte: mehr Gebäude und mehr Personal. In puncto Personal arbeiten derzeit 498 Personen beim Service Foyers scolaires (415,84 Vollzeitäquivalente). Der Turn-Over lag im vergangenen Jahr bei 7,02 Prozent, der Durchschnitt liegt bei 10,50 Prozent. Die Fehlzeiten lagen in den vergangenen Jahren zwischen 8 und 10 Prozent.
Wir legen viel Wert darauf, dem Personal gute Arbeitsverträge anzubieten. So müssen die Mitarbeitenden z. B. nicht an einem Tag nach einer Unterbrechung von mehreren Stunden nochmal zurückkommen („Coupé“), wie es in anderen Gemeinden der Fall ist. Fakt ist aber, dass es eine enorm große Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gibt, und dass die Stadt Luxemburg auch gewisse Anforderungen stellt, insbesondere in Bezug auf die Sprachkenntnisse. Leider erfüllen viele Personen diese Anforderungen nicht.
Wir haben deshalb eine Strategie ausgearbeitet. Diese besteht darin, dass wir Personen, die nicht über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen, mit einem befristeten Vertrag einstellen, der in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt werden kann, wenn die betreffenden Personen nach einiger Zeit die Anforderungen im Bereich der Sprachkenntnisse erfüllen. Wir planen eine ganze Reihe von Gebäuden und führen eine Projektionsarbeit durch in Bezug auf die Entwicklung der Kinderzahlen in den einzelnen Stadtvierteln. Rätin Brömmel kann später gerne die Liste mit den Standorten der geplanten Gebäude einsehen.
Artikel 13 Absatz 3 des Gemeindegesetzes (<em>loi communale</em>) betrifft das Initiativrecht, gemäß dem jedes einzeln agierende Mitglied des Gemeinderats der vom Schöffenrat festgesetzten Tagesordnung einen oder mehrere Punkte hinzuzufügen lassen kann, mit dem bzw. denen es den Gemeinderat befassen möchte.
Derartige Vorschläge müssen bei der Bürgermeisterin mittels eines schriftlichen und begründeten Antrags mindestens drei Tage vor der Gemeinderatssitzung eingereicht werden.









